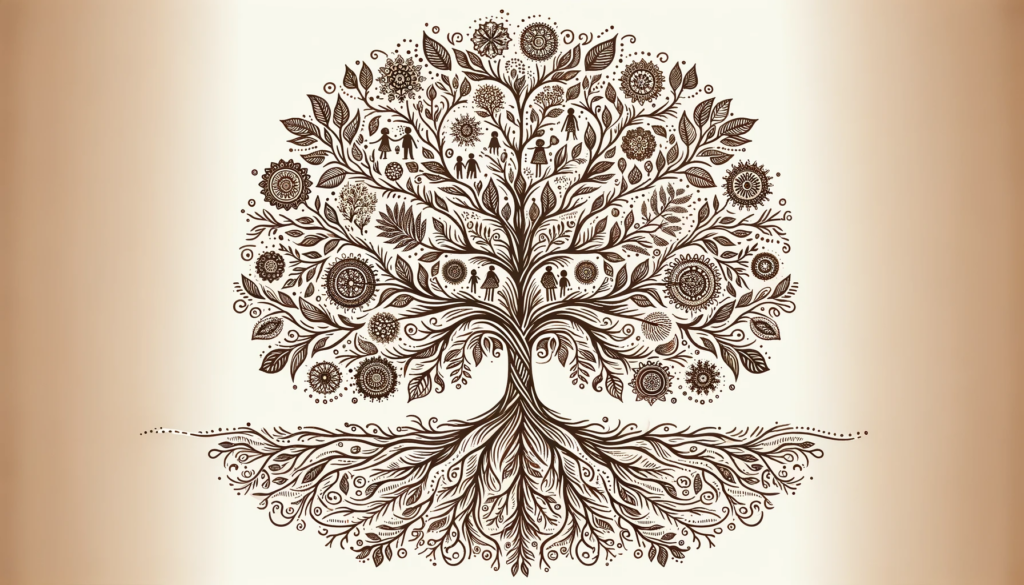Lesezeit: 14 Minuten
Einleitung
Als Bürger von Fürth habe ich schon immer davon geträumt, dass unsere Stadt mehr sein könnte als nur ein Ort zum Leben. Ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, um eine Vision zu teilen, die ich für meine Stadt sehe – eine Vision, in der Daten und Wissenschaft uns helfen, unser Leben zu verbessern und unsere Gemeinschaft zu stärken.
Diese Geschichte ist mehr als nur eine fiktionale Erzählung; sie ist ein möglicher Blick in die Zukunft. Mit der richtigen Planung, der Unterstützung der Bürger und dem Einsatz moderner Technologien könnten die beschriebenen Szenarien Realität werden. Durch die Nutzung von Open Data und der Einbindung der Bürger in die Stadtplanung könnten wir Fürth zu einem Modell für andere Städte machen, zu einer echten Wissenschaftsstadt.
Lass uns gemeinsam träumen und daran arbeiten, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die Geschichte, die du gleich lesen wirst, ist ein Schritt in diese Richtung – eine Inspiration für das, was möglich ist, wenn wir die Macht der Daten nutzen und teilen.
Eine Kurzgeschichte aus der Zukunft: “Die Wissenschaftsstadt Fürth”
In einer nicht allzu fernen Zukunft erlebte die mittelfränkische Großstadt Fürth eine bemerkenswerte Transformation. Unter der visionären Führung von Bürgermeister Dr. Thomas Jung wurde Fürth zur Vorzeigestadt der Wissenschaft und Datenanalyse.
Die Geburt einer Vision
Als Bürger von Fürth und jemand, der leidenschaftlich an die Macht der Daten glaubt, habe ich immer davon geträumt, dass unsere Stadt zu einem Modell für wissenschaftliche und technologische Innovation wird. Fürth, eine Stadt mit Geschichte und Charakter, sollte ein Vorreiter in der Nutzung von Open Data werden, um das Leben seiner Bewohner zu verbessern.
„Fürth hat eine Reise begonnen,“ verkündete Dr. Thomas Jung vor einem vollen Auditorium im Rathaus. „Eine Reise, die uns in eine neue Ära führen wird. Wir sind die Wissenschaftsstadt, und das bedeutet, dass wir Wissen schaffen, nutzen und teilen.“
Die Macht der Daten
Alles begann mit der Erkenntnis, dass Daten das neue Öl sind. Wir sammelten Daten aus Krankenhäusern, analysierten Bettenbelegungen und Notfallstatistiken in Verbindung mit Wetterdaten und Bevölkerungsstatistiken. Ein Muster wurde sichtbar: An heißen Tagen stiegen die Notfälle dramatisch an, besonders in bestimmten Stadtteilen.
Detaillierte Analyse der Krankenhausdaten
Bei näherer Analyse der Krankenhausdaten konnten wir spezifische Muster und Zusammenhänge erkennen:
- Sportverletzungen: Bei angenehmeren Temperaturen (15-25 Grad Celsius) stieg die Anzahl der Sportverletzungen signifikant an. Die Menschen waren aktiver, nahmen an Outdoor-Aktivitäten teil und betrieben mehr Sport. Dies führte zu einer Zunahme von Verletzungen wie Zerrungen, Knochenbrüchen und Verstauchungen.
- Hitzeerkrankungen: Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius nahm die Anzahl der Hitzebedingten Notfälle deutlich zu. Diese Fälle umfassten Hitzeschläge, Dehydrierung und Kreislaufprobleme, besonders bei älteren Menschen und Kleinkindern.
- Atemwegserkrankungen: An Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um die 25-30 Grad Celsius stiegen die Fälle von Atemwegserkrankungen wie Asthmaanfällen und Bronchitis. Dies war besonders in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung zu beobachten.
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Bei extremen Temperaturschwankungen – sowohl bei großer Hitze als auch bei plötzlichen Kälteeinbrüchen – stiegen die Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders gefährdet waren ältere Menschen und solche mit bereits bestehenden Gesundheitsproblemen.
- Unfälle durch Glätte: In den Wintermonaten, bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius, nahmen die Fälle von Knochenbrüchen und Verstauchungen durch Glätteunfälle zu. Besonders betroffen waren ältere Menschen und Kinder.
Diese detaillierten Daten halfen uns, gezielte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und die Notfallversorgung zu verbessern.
Transparenz und Bürgerbeteiligung
Eine der größten Herausforderungen für uns als Stadt war die Einbindung der Bürger in die Planung und Entwicklung. In Fürth führten wir eine interaktive Plattform ein, auf der Bürger live Daten zu verschiedenen Aspekten des Stadtlebens einsehen konnten. Notfallstatistiken, Verkehrsdaten, Umweltdaten – alles war transparent und zugänglich. Dies förderte nicht nur das Vertrauen, sondern ermöglichte auch eine breite Beteiligung der Bürger an der Stadtgestaltung.
Smarte Lösungen für eine bessere Stadt
Wir installierten smarte Bänke, ausgestattet mit Solarzellen und Sensoren, die Wetterdaten sammelten und Echtzeitinformationen zur Luftqualität und Temperatur lieferten. Diese Daten flossen in unsere zentrale Datenplattform ein, die wir entwickelt hatten, um die Stadt in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.
Zusätzlich entwickelten wir die „Fürth App“, die datenschutzkonform Verkehrsströme live übermittelte. Die App half den Bürgern, die besten Routen zu finden und trug zur Reduzierung von Staus bei. Doch die App konnte noch viel mehr:
- Echtzeit-Verkehrsdaten: Die App zeigte nicht nur Verkehrsstaus, sondern auch alternative Routen, freie Parkplätze und die Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel an.
- Gesundheitsdaten: Mit der Einbindung von Fitness-Trackern und Smartwatches konnten Bürger ihre Vitaldaten anonymisiert teilen, um ein Echtzeit-Bild der allgemeinen Gesundheit der Stadt zu erstellen. Diese Daten halfen dabei, Notfallressourcen effizient zu verteilen und Präventivmaßnahmen zu planen.
- Soziale Interaktionen: Die App zeigte Veranstaltungen, Treffpunkte und soziale Aktivitäten an und ermöglichte es den Bürgern, sich zu vernetzen und an Gemeinschaftsprojekten teilzunehmen.
- Umweltdaten: Luftqualität, Lärmpegel und Wetterbedingungen wurden kontinuierlich überwacht und in der App angezeigt, um die Bürger über die Umweltbedingungen in ihrer Nähe zu informieren.
- Energieverbrauch: Bürger konnten ihren Energieverbrauch verfolgen und Tipps zur Energieeinsparung erhalten. Die App förderte den Einsatz von erneuerbaren Energien und half dabei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
- Wellness- und Fitnessdaten: Die App konnte auch Daten von Fitnesstrackern und Smartwatches nutzen, um den allgemeinen Gesundheitszustand der Bürger zu überwachen. Das half nicht nur Einzelpersonen, ihre Fitnessziele zu erreichen, sondern ermöglichte es der Stadt auch, öffentliche Gesundheitsprogramme besser zu planen.
Maßnahmen gegen die Hitze
Durch die Analyse der Daten konnten wir gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen von Hitzeperioden zu mildern. Hier sind einige der Maßnahmen, die in Fürth implementiert wurden:
- Trinkwasserstellen: Über die gesamte Stadt verteilt wurden zusätzliche Trinkwasserstellen eingerichtet. Diese Stationen boten den Bürgern kostenlos sauberes und gekühltes Wasser, um Dehydrierung vorzubeugen.
- Sonnenschutzspender: An strategischen Orten, insbesondere in Parks und öffentlichen Plätzen, installierten wir Spender für Sonnencreme. Diese Spender ermöglichten es den Bürgern, sich vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen.
- Kühlräume und Schutzzonen: In besonders betroffenen Stadtteilen richteten wir Kühlräume und Schutzzonen ein, die klimatisiert waren und den Menschen an heißen Tagen Schutz boten.
- Grünflächen und Dachbegrünung: Wir erhöhten die Anzahl der Grünflächen in der Stadt und förderten die Begrünung von Dächern. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, die Umgebungstemperaturen zu senken und ein angenehmeres Mikroklima zu schaffen.
- Smarte Bewässerungssysteme: Um die Grünflächen gesund und kühl zu halten, installierten wir smarte Bewässerungssysteme, die sich automatisch an die Wetterbedingungen anpassten und Wasser effizient nutzten.
- Öffentliche Sprühnebelanlagen: In belebten Fußgängerzonen und Parks installierten wir Sprühnebelanlagen, die an heißen Tagen eine erfrischende Abkühlung boten.
Innovative Stadtplanung
Aber es gibt noch mehr, was wir tun können. Die Stadtplanung kann durch innovative Ansätze wie Vertical Gardening, urbane Farmen und smarte Beleuchtungssysteme revolutioniert werden. Hier sind einige Ideen:
- Vertical Gardening: Gebäude in der Stadt könnten mit vertikalen Gärten ausgestattet werden, um die Luftqualität zu verbessern, die Umgebungstemperaturen zu senken und zusätzliches Grün in die Stadt zu bringen.
- Urbane Farmen: Durch die Integration von urbanen Farmen könnten wir nicht nur die Nahrungsmittelproduktion lokal unterstützen, sondern auch Bildungsprogramme für Schulen und Gemeinschaften schaffen.
- Smarte Beleuchtung: Energieeffiziente, smarte Beleuchtungssysteme könnten nicht nur den Energieverbrauch senken, sondern auch die Sicherheit in der Stadt erhöhen, indem sie sich an die Anwesenheit von Personen anpassen und automatisch auf Bewegungen reagieren.
- Gemeinschaftsflächen: Die Schaffung von mehr Gemeinschaftsflächen, wie Parks und Plätze, die mit kostenlosem WLAN und Ladestationen ausgestattet sind, fördert die soziale Interaktion und schafft Orte der Erholung und des Austauschs.
- Intelligente Abfallwirtschaft: Smarte Abfallbehälter, die den Füllstand überwachen und automatisch melden, wenn sie geleert werden müssen, könnten die Effizienz der Abfallentsorgung verbessern und die Stadt sauberer halten.
Der Mehrwert der Wissenschaftsstadt
Durch die Analyse der Daten konnten wir gezielte Maßnahmen ergreifen. In besonders betroffenen Stadtteilen richteten wir zusätzliche Gesundheitsstationen und Kühlräume ein, um den Menschen an heißen Tagen Schutz zu bieten. Die städtische Infrastruktur wurde angepasst, um besser auf klimatische Veränderungen reagieren zu können. Die App informierte Bürger über alternative Routen und trug so zur Verkehrsberuhigung bei.
Diese Maßnahmen waren nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern Teil einer langfristigen Vision, die darauf abzielte, Fürth zu einer resilienten und nachhaltigen Stadt zu machen.
Die Vision einer vernetzten Zukunft
„Wir sind eine Stadt der Wissenschaft. Das bedeutet, dass wir Wissen schaffen und teilen. Wenn wir zeigen, wie erfolgreich unser Modell ist, helfen wir anderen Städten, uns nachzutun,“ erklärte Dr. Jung. „Wir teilen unser Wissen, weil wir glauben, dass eine vernetzte und informierte Gesellschaft eine bessere Gesellschaft ist.“
Meine Vision für Fürth
Ich habe einen Traum, dass eines Tages unsere Stadt Fürth ein leuchtendes Beispiel für die Welt sein wird. Eine Stadt, in der Daten genutzt werden, um das Leben der Menschen zu verbessern, in der Transparenz und Bürgerbeteiligung keine leeren Versprechen sind, sondern gelebte Realität.
Ich habe einen Traum, dass unsere Kinder in einer Stadt aufwachsen, in der smarte Bänke ihnen nicht nur Schatten, sondern auch Wissen bieten, in der Trinkwasserstellen ihnen Erfrischung und Sonnenschutzspender ihnen Sicherheit bieten.
Ich habe einen Traum, dass wir die Macht unserer Daten nutzen, um ein besseres Leben für alle zu schaffen. Dass wir unsere Straßen kühler, unsere Luft sauberer und unsere Gemeinschaft stärker machen. Dass wir unsere Erkenntnisse teilen und andere Städte dazu inspirieren, unserem Beispiel zu folgen.
Ich habe einen Traum, dass wir eines Tages in einer Welt leben, in der jede Stadt eine Wissenschaftsstadt ist, in der Wissen geteilt und genutzt wird, um die Lebensqualität aller zu verbessern.
Das ist mein Traum für Fürth und für die Welt. Möge dieser Traum Wirklichkeit werden, durch die Macht der Daten und die Weisheit der Menschheit.
Realitätscheck
Nach dieser Vision für Fürth ist es wichtig zu prüfen, was bereits in unserer Stadt realisiert wurde und welche Initiativen in Bezug auf Smart City und Open Data bereits existieren.
Aktuelle Initiativen in Fürth
- Open Data Plattformen: Fürth hat bereits Initiativen gestartet, um Daten zugänglich zu machen. Die Stadtverwaltung bietet auf ihrer Webseite verschiedene Datensätze an, die Bürger und Entwickler nutzen können, um innovative Anwendungen zu erstellen. Diese Daten umfassen unter anderem Geodaten, Verkehrsdaten und Umweltinformationen.
- Smart City Projekte: Fürth ist Teil der „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Diese Projekte zielen darauf ab, digitale Lösungen für die nachhaltige Stadtentwicklung zu testen und zu implementieren. In Fürth wurden Pilotprojekte in Bereichen wie Energieeffizienz und Verkehrsinfrastruktur gestartet.
- Energie- und Umweltprojekte: Es gibt bereits Bemühungen, Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Beispielsweise werden Energiemonitoring-Systeme eingesetzt, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren.
- Mobilitätslösungen: Fürth arbeitet an der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch den Einsatz von Smart Traffic Management Systemen. Diese Systeme nutzen Echtzeitdaten, um den Verkehrsfluss zu optimieren und Staus zu reduzieren. Zudem gibt es Initiativen zur Förderung von E-Mobilität, einschließlich der Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
- Digitale Bürgerbeteiligung: Die Stadt setzt auf digitale Plattformen, um die Bürgerbeteiligung zu fördern. Bürger können über Online-Portale an der Stadtplanung teilnehmen, Feedback geben und sich über laufende Projekte informieren. Dies fördert die Transparenz und ermöglicht eine aktive Mitgestaltung der Stadtentwicklung.
Fazit
Fürth hat bereits wichtige Schritte unternommen, um sich zu einer Smart City zu entwickeln. Die vorhandenen Initiativen und Projekte legen eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung der Vision einer vernetzten und datengetriebenen Stadt. Es gibt jedoch noch viel Potenzial, diese Ansätze weiter auszubauen und zu optimieren, um die Lebensqualität der Bürger weiter zu verbessern und die Stadt nachhaltiger und zukunftsfähiger zu machen.
Was man so alles findet
Offizielle Open Data Portale
- Open Data Bayern ([1]) ist das zentrale Portal für offene Daten der öffentlichen Verwaltung in Bayern. Hier können verschiedene Geodaten wie Verwaltungsgrenzen, Hausumringe, Landschaftsmodelle etc. für ganz Bayern heruntergeladen werden.
- Das Geoportal Bayern ([6]) bietet einen zentralen Zugriff auf Geodaten und Geodatendienste der bayerischen Geodateninfrastruktur, darunter auch für Fürth.
- Der Landkreis Fürth ([13]) betreibt ein eigenes Geoportal mit einer Übersichtskarte und geografischen Daten für den Landkreis.
- Die Stadt Erlangen ([8]) stellt einige Datensätze wie Statistiken, Wahlergebnisse und Geometriedaten als Open Data zur Verfügung.
Inoffizielle Portale
- fuerth.io ([10]) ist ein inoffizielles Open Data Portal mit Karten, Visualisierungen und Statistiken zur Stadt Fürth, betrieben von Freiwilligen.
- Auf GitHub ([12]) gibt es ein „Code for Fürth“ Repository mit Open Data Projekten rund um Fürth.
- Das **Solar- und Gründachpotenzialkataster** ([9]) des Landkreises Fürth listet weitere Open Data Links für die Region auf.
Insgesamt gibt es bereits einige nützliche Quellen für offene Daten zu Fürth, insbesondere im Bereich Geodaten und Statistiken. Die Datenabdeckung und Aktualität können jedoch variieren. [1,6,8,9,10,12,13]
Quellen:
[1] https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/0485783171228
[2] https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2018/Downloads/180221-vbw-Studie-Open-Data_final.pdf
[3] https://geodaten.bayern.de/opengeodata/
[4] https://community.openstreetmap.org/t/bayern-ab-01-01-2023-sind-viele-geobasisdaten-der-vermessungsverwaltung-kosten-frei-verfugbar/7051
[5] https://www.ldbv.bayern.de/produkte/weitere/opendata.html
[6] https://geoportal.bayern.de/geoportalbayern/
[7] https://www.adbv-nuernberg.de
[8] https://erlangen.de/aktuelles/opendata
[9] https://solarkataster.landkreis-fuerth.de/links
[10] https://www.fuerth.io
[11] https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/fuerth
[12] https://github.com/fuerth
[13] https://www.landkreis-fuerth.de/daten-startseite/geoportal.html
[14] https://community.openstreetmap.org/t/bayern-ab-01-01-2023-sind-viele-geobasisdaten-der-vermessungsverwaltung-kosten-frei-verfugbar/7051?page=2
[15] https://www.bitkom.org/Smart-City-2021/Fuerth
[16] https://www.vgn.de/web-entwickler/open-data/
[17] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/F%C3%BCrth
[18] https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2021/pm126/index.html
[19] https://tourismus.bayern/artikel/rueckblick-netzwerktreffen-juli-2023/
Wie kommen die Daten zustande
Die Daten auf Open Data Bayern werden aus verschiedenen Quellen der öffentlichen Verwaltung in Bayern bezogen und aktualisiert. Hier sind einige der wichtigsten Datenquellen und deren Aktualisierungszyklen:
Bayerische Vermessungsverwaltung
- Geodaten wie das Digitale Geländemodell (DGM) und das Digitale Orthophoto (DOP) werden von der Bayerischen Vermessungsverwaltung bereitgestellt und in der Regel losweise nach Fertigstellung neuer Aufnahmen aktualisiert [3][4].
- Hausumringe und Verwaltungsgrenzen werden ebenfalls von der Bayerischen Vermessungsverwaltung bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert [3].
Kommunale Verwaltungen
Einwohnerzahlen, Wahlergebnisse und Statistiken werden von den jeweiligen kommunalen Verwaltungen, wie den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, bereitgestellt und typischerweise jährlich oder nach neuen Erhebungen aktualisiert [1].
Fachbehörden
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Bodenrichtwertewerden von den zuständigen Fachbehörden wie den Naturschutzbehörden und den Gutachterausschüssen bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert [1].
Weitere Quellen
Öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kitas werden von den zuständigen Bildungs- und Jugendämtern bereitgestellt und aktualisiert [1].
Die Daten werden kontinuierlich weiterentwickelt und das Portal Open Data Bayern wird regelmäßig mit neuen Datensätzen und Aktualisierungen erweitert. Die genauen Aktualisierungszyklen können je nach Datensatz variieren und sind in den Metadaten der jeweiligen Datensätze angegeben [1][3][4].
Quellen:
[1] https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/0485783171228
[2] https://opendata.muenchen.de/pages/aktuelles
[3] https://www.ldbv.bayern.de/produkte/weitere/opendata.html
[4] https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=dgm1
[5] https://community.openstreetmap.org/t/bayern-ab-01-01-2023-sind-viele-geobasisdaten-der-vermessungsverwaltung-kosten-frei-verfugbar/7051
[6] https://opendata.muenchen.de/pages/links
[7] https://www.adbv-bayreuth.de/aktuell/archiv/3429.html
[8] http://www.geobranchen.de/mediathek/geonews/item/bayerische-vermessungsverwaltung-zahlreiche-geobasisdaten-werden-als-opendata-zur-verf%C3%BCgung-gestellt
Von anderen lernen
Open Data in dänischen Städten
Dänemark ist eines der führenden Länder in Europa, wenn es um Open Data und die Bereitstellung offener Daten durch Städte und Kommunen geht. Einige wichtige Initiativen und Plattformen sind:
Open Data DK
Open Data DK ist eine Vereinigung dänischer Kommunen und Regionen mit dem Ziel, Regierungsdaten für Bürger und Unternehmen offen und nutzbar zu machen. Ziele sind mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung und die Förderung datengetriebenen Wachstums. [1][4]
- Ende 2019 waren 40 Kommunen, 2 Regionen und weitere öffentliche Institutionen Mitglied.
- Es finden regelmäßig Dialogveranstaltungen mit Unternehmen und Hackathons statt, um die Nutzung der Daten zu fördern.
- Die Open-Data-Plattform enthält Daten zu Themen wie Verkehr, Freizeit, Recycling, Gesundheit und mehr.
Smart Aarhus
Die Stadt Aarhus ist eine Vorreiterin im Bereich Smart City und Open Data in Dänemark. [2][3][7]
- Die Open Data Aarhus Plattform gibt Zugriff auf offene Daten der Stadt für Entwickler, Unternehmen und Bürger.
- Im Rahmen von Smart Aarhus gibt es Testumgebungen wie das Aarhus City Lab zum Ausprobieren von Smart-City-Lösungen.
- Das TAPAS-Projekt erforscht hochpräzise Positionierung in Echtzeit mithilfe eines neuen Satellitensystems.
Copenhagen Solutions Lab
Das Copenhagen Solutions Lab ist eine Plattform der Stadt Kopenhagen für Open Data. [1][5]
- Der City Data Exchange bündelt öffentliche und private Daten zu Themen wie Stadtleben, Infrastruktur, Klima, Wirtschaft und mehr.
- Ziel ist die Bereitstellung von Daten zur Entwicklung innovativer Lösungen für nachhaltige und lebenswerte Städte.
- Es wurden erste Anwendungen wie Journey Insight (CO2-Fußabdruck) und Energy Insight (Energieverbrauch) entwickelt.
Insgesamt zeigen diese Beispiele, dass dänische Städte Open Data als wichtigen Baustein zur Förderung von Transparenz, Partizipation und innovativen Lösungen für die Herausforderungen in Städten sehen. Aarhus war hier mit Smart Aarhus und der Open Data Plattform eine treibende Kraft. [2][3][7]
Quellen:
[1] https://cphsolutionslab.dk/en/projekter/data-platforms/open-data
[2] https://aarhus.dk/english/visit-aarhus/smart-aarhus
[3] https://nscn.eu/system/files/files/Smart%20Aarhus%20strategy%20English%202021.pdf
[4] https://www.opengovpartnership.org/members/denmark/commitments/DK0054/
[5] https://stateofgreen.com/en/news/city-of-copenhagen-launches-the-worlds-first-big-data-platform-for-cities/
[6] https://kk.statistikbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?PLanguage=1
[7] https://nscn.eu/Aarhus/OpenData
[8] https://aarhusclearinghouse.unece.org/resources-keyword?individual=1
[9] https://www.opendata.dk
[10] https://smartcities.au.dk/networks-and-partnerships/open-data-aarhus
[11] https://www.back4app.com/database/back4app/list-of-cities-in-denmark
[12] https://www.eti.uni-siegen.de/ws/publikationen/repository/big_data_analytics_in_smart_mobility_-_modeling_and_analysis_of_the_aarhus_smart_city_dataset.pdf
[13] https://dataportals.org/portal/odaa_denmark
[14] https://andyhub.com/archive/organizational-analysis-of-open-data-aarhus-odaa/
[15] https://www.aakb.dk/english/open-data-aarhus
Datenqualität am Beispiel Aarhus
Aarhus war eine der ersten Städte in Dänemark, die eine Open Data Plattform namens Open Data Aarhus (ODAA) eingeführt hat. Hier werden einige Maßnahmen zur Datenqualitätssicherung ergriffen:
- Datenübersicht und -vorbereitung: Vor der Veröffentlichung wird eine Übersicht über vorhandene Datensätze erstellt und diese werden für die Veröffentlichung vorbereitet [3]. Dies beinhaltet Prüfungen auf Vollständigkeit, Konsistenz, Relevanz etc.
- Metadaten: Für jeden Datensatz werden umfangreiche Metadaten bereitgestellt, die die Datenqualität und -herkunft dokumentieren [11]. Metadaten sind ein wichtiger Faktor für die Interpretation und Nutzbarkeit von Daten.
- Kontinuierliche Veröffentlichung: Neue Datensätze werden laufend auf der Plattform veröffentlicht, was auf Prozesse zur Datenaufbereitung und -qualitätssicherung hindeutet [10].
- Zusammenarbeit mit Partnern: Die Plattform ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Universität Aarhus, der Region Midtjylland und anderen, was eine Qualitätssicherung durch mehrere Experten impliziert [6][7].
Quellen:
[1] https://publicgovernance.de/media/PG_Winter21_22_Smart_City.pdf
[2] https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/large-scale-pilots-smart-cities-and-communities
[3] https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Behoerden/Beratung/Methoden/open_data_handbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=8
[4] https://www.aarhus-konvention.de/aarhus-konvention/konventionsorgane/
[5] https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/positionierung-des-bmvi.pdf?__blob=publicationFile
[6] https://dataportals.org/portal/odaa_denmark
[7] https://nscn.eu/Aarhus
[8] https://www.aarhus-konvention.de/aarhus-konvention/inhalt/zugang-zu-umweltinformationen/
[9] https://www.bmuv.de/themen/umweltinformation/aarhus-konvention
[10] https://www.aakb.dk/english/open-data-aarhus
[11] https://data.europa.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_2.2_open_data_quality_de_edp.pdf